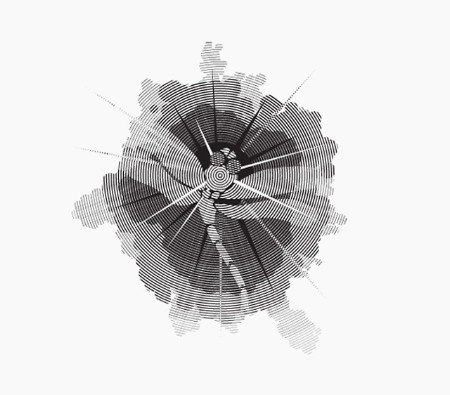Vergiss mein nicht
Wir erleben in Videospielen Siege und Niederlagen, Freude und Leid – doch wollen wir unsere Gefühle beschreiben, fehlen uns oft die Worte. GEE hat acht Autoren gebeten, ihre intensivsten Spielmomente zu Papier zu bringen
Zeitschleifen und Gezeiten von Felix Scharlau
Noch einmal atmet er tief durch und drückt die Klinke. Also, den zerfressenen Metallstumpen, der einmal eine Klinke gewesen ist. Die Angeln geben widerwillig nach, dröhnend schwingt die Eichentür auf. Willkommen in der Hölle, denkt er noch, bevor das Kerzenlicht ihn erfasst. Willkommen in der Hölle, dem einzigen Ort, an dem sich nie etwas ändert. Im Schankraum sieht es aus wie gestern, vorgestern, vorhin und wohl auch überübermorgen. Nur eines ist bei diesem Besuch anders, aber das wesentlich: die ungewaschenen, schlecht frisierten und mit albernem Silberschmuck behängten Köpfe, die sich zuvor stets mechanisch zu ihm umgedreht hatten, sind nicht mehr zu sehen. Ihre stumpfen Pupillen, die im Weiß der Augen trieben wie nervöse Nussschalen, starren jetzt irgendeinen anderen Punkt auf diesem Eiland an. Die Kneipe ist leer. Und das ist gut. Denn Veränderung ist in dieser Welt immer ein gutes Zeichen. Eine fast idyllische Ruhe umgibt ihn, nur gestört durch das schwappende Hafenbrackwasser, das sich unter den besudelten Holzplanken ans Ufer erbricht. Wäre nicht der Gestank von Urin und geronnenem Blut, er würde sich jetzt hinsetzen und ausruhen. Aber er muss auf der Hut sein. Wo sind die Stammtrinker der Insel? All die verrohten Seelen, die in der Lebenslotterie nur Nieten gezogen hatten? Zum Beispiel solche: annähernd einhundert Prozent Männeranteil hier und den umliegenden Milliarden Quadratkilometern.
Jeden Tag mindestens ein Messer an der Kehle. Kaum Jobs. Und als Krönung: Skorbut-Freiabos, die für eine Lebenserwartung von 32,7 Jahren sorgen - jedenfalls so lange, bis die Spanier sich für die letzten weißen Flecken auf ihren Seekarten zu interessieren beginnen.
Das alles muss ihm jetzt egal sein. Er durchquert den Raum mit schnellen Schritten und nimmt dabei so viele leere Krüge von den Tischen, wie er tragen kann. Er hat eine Idee, wie er diesen Trottel aus dem Gefängnis befreien kann. Auch wenn ihm nicht ganz einleuchtet, was er eigentlich mit dem Ratten fressenden Nichtsnutz anfangen soll. Aber die Maxime in dieser Welt lautet nun einmal: Was geht, muss ausprobiert, und was gefunden wird, mitgenommen werden. So auch die schweren Krüge. Er geht in die Küche, füllt einen von ihnen mit Grog aus einem -großen Fass und rennt los. Durch die Küche. Durch den Schankraum. Auf die Straße und rechts den Berg hoch. Über den Marktplatz und nach links. Zum Gefängnis und in Richtung Zelle. Während er rennt, riskiert er alle paar Meter einen Blick nach unten und registriert ärgerlich, dass der Grog den Krug langsam zersetzt. Dieses Teufelszeug. Gerade als er den ätzenden Rest auf Otis' Zellenschloss schütten will, ist der Krug zur Gänze verschwunden. Das geht so also nicht, er muss wohl schneller sein. Er läuft frustriert zurück zur Kneipe, um es von Neuem zu versuchen. So geht das sieben Tage lang, immer und immer wieder mit demselben Ergebnis. Erst am achten Tag kommt er endlich auf die Idee, den Grog unterwegs aus dem halb zerfressenen Krug in einen intakten umzufüllen - und schafft es bis ans Ziel. Otis feiert seine Freilassung aus dem Gefängnis kurz und heftig: Er jubelt, bricht sein Versprechen und rennt davon. Wahrscheinlich zu den anderen Trinkern. Diese gottverdammte Insel.
Felix Scharlau, geboren 1976, lebt als Journalist, Musiker sowie Autor von Kurzprosa, Hörspielen und unverkäuflichen Sitcom-Konzepten in Köln. Zurzeit arbeitet er an der Fertigstellung eines neuen Hörspiels "GRAS oder wie er die Welt sah"
Reise ins Labyrinth von Linus Volkmann
Hinter mir Gespenster. Schon wieder. Mein blondes Haar schwitzt im Licht. Ich bin wieder drauf. Ich meine, Liquid Ecstasy lässt sich so verdammt schlecht -dosieren, irgendwann kommt man zwangsläufig wieder zurück zur Tablette. "Pillenopfer", denken meine Freunde, wenn sie mich sehen, wenn sie hören, wie ich zwischen den Worten so komisch kauen muss. Aber sie sagen nichts. Und wo stecken diese Freunde überhaupt? Weg? Schon heim? Oder nie hier gewesen in dem Labyrinth unter dem Frankfurter Flughafen, der Heimat von Sven Väths Nachtpalast "Dorian Gray"? Die Beats wiederholen sich. Wackowackowacko, diudiudiudiudiudiu, ä, ä, ä, ä, ä ... Nervenkrieg ist hier Style. Vielleicht mal ein Stück Obst essen? Hat neben Vitaminen auch gute Farben. Fällt man mit auf in diesem Loch hier. Richtig grell. Hoffentlich bekomme ich es runter, mein Mund ist so trocken. Noch zwei Runden auf dieser eckigen Tanzfläche, dann ist wieder mal Pause. Vielleicht treffe ich in der Zwischensequenz dieses blonde Rave-Mädchen mit der Schleife im Haar wieder. Die will ich küssen. Ich schmecke nach Kirsche. Immerhin. Das wird sie mögen. Das mögen alle. Hoffentlich halte ich überhaupt noch so lange durch. Schon wieder die Gespenster.
Linus Volkmann, geboren 1973 in Frankfurt/Main, lebt und arbeitet unter anderem als Handmodel in Köln. Vergangenes Jahr erschien der Enthüllungsroman "Anke" (Ventil Verlag), diesen Herbst sein Beitrag "3 Tage wach 1957" in der Anthologie "Saturday Night" (Piper)
Der milde Mond von Tobias O. Meißner
Der Sand, der durch die Uhr der Zeit läuft, besteht nur aus Erinnerungen. Und nur zu gerne erinnere ich mich daran, wie es war, als man mich einen jungen Prinzen, einen Helden nannte. Als ich an Wänden entlanglaufen konnte wie ein anmutiges Insekt. Als ich dem schönen Mädchen hinterhereilte durch die zarten Vorhänge des verwunschenen Schlosses. Als ich über Geister hinwegsprang, um sie hinterrücks zu übertrumpfen, und ich die Vogelvoliere aufwärts kletterte, um an Fassaden zu tanzen, während der Mond mir ein nebelmüdes Lächeln schenkte, wohl wissend, wie vergänglich all dies war. All dies ist nun Wüste. Versunken und vertan. Und ich fragte mich: wie oft schon?
Wie oft habe ich der Versuchung nachgegeben, mit greiser Hand alles wieder zurückzudrehen, jeden Fehltritt, jedes Umkommen und jede Ungeschicklichkeit ungeschehen zu machen, um ewig aufs Neue wagen zu dürfen? Der milde Mond weiß um die Antwort.
Und er weiß auch, dass ich es wieder tun werde.
Denn ich bin alt und pergament, doch ich will immer nur ein Prinz noch bleiben - und eins sein dürfen mit dem kostbaren Sand der Zeit.
Tobias O. Meißner, geboren 1967, hat zwölf Romane veröffentlicht, zuletzt das Fantasyspektakel "Die Dämonen" beim Piper Verlag. In seiner Freizeit textet er Vampircomics, schreibt Hörspiele und begibt sich als "Wipeout"-Pilot auf die Jagd nach Streckenrekorden
Das Ziel von Karl Olsberg
Wie ein gewaltiger, stählerner Pfeil ragt das Sternenschiff empor. Der Anblick erfüllt Cäsars Herz mit Stolz. Sein Blick schweift über die versammelten Ehrengäste. Sie alle sollen den endgültigen Triumph des Römischen Reichs miterleben.
"Sechstausend Jahre sind vergangen", sagt Cäsar mit würdevoller Stimme, "seit unsere Vorfahren eine kleine Siedlung namens Rom gegründet haben. Wir haben geforscht, Handel getrieben, Kriege geführt und den Reichtum unserer Nation vermehrt. Nun werden wir die Grenzen dieser Welt hinter uns lassen. Schon bald wird dieses Schiff den fünften Planeten des Alpha-Centauri-Systems erreichen und den Ruhm des Römischen Reichs weit über die Grenzen des Sonnensystems hinaus ..." Ein Tumult unterbricht ihn. Ein Mann versucht sich an den Wächtern vorbei auf die Bühne zu drängen. "Lasst mich los!", schreit er. "Ich muss unbedingt zu ihm!"
Cäsar erkennt Alberto Unapietra, einen jungen Physiker, der wesentlich zum Erfolg des Projekts beigetragen hat. "Lasst ihn zu mir", befiehlt er. Unapietra wedelt mit einem Stapel Papier. "Ihr dürft das Schiff nicht starten lassen", ruft er. "Es würde das Ende der Welt bedeuten!"
Ein Raunen geht durch die Menge. Jeden anderen, der eine solche Behauptung aufgestellt hätte, würde man für einen durchgedrehten Spinner halten - doch Unapietra ist einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Welt. Ohne ihn gäbe es das Sternenschiff nicht. "Wie kommst du dazu, so etwas zu sagen?", fragt Cäsar.
Unapietra hält ihm die Blätter hin, die mit komplizierten Formeln bekritzelt sind. "Hier, ich habe es ausgerechnet. Das Ergebnis ist eindeutig: Unsere Welt ist nicht real!" Cäsar sieht sein eigenes Unverständnis in den Gesichtern der Zuhörer gespiegelt. "Verzeih mir, wenn ich dir nicht ganz folgen kann." Unapietra wendet sich an die Anwesenden. "Habt ihr euch je gefragt, warum die Lichtgeschwindigkeit konstant ist? Warum sich ein Photon erst dann entscheidet, ob es eine Welle oder ein Teilchen ist, wenn man es beobachtet? Warum die Zeit offenbar in diskreten Schritten abläuft? Habt ihr euch je gefragt, warum das Universum so seltsam ist?" Die Zuhörer schütteln verwirrt die Köpfe.
"Ganz einfach: Das alles spart Rechenleistung! Unser Universum ist so, wie es ist, weil es sonst nicht berechenbar wäre. Und das kann nur bedeuten, dass es berechnet wird! Wir alle sind Teil einer gigantischen Computersimulation!" Cäsar lächelt milde. "Selbst wenn es so wäre, lieber Unapietra, so ist dies doch wohl eine rein philosophische Frage ohne praktische Konsequenzen." "Im Gegenteil! Ich habe Grund zu der Annahme, dass unser Universum ein Ziel hat", erwidert Unapietra. "Es ist eine Art Wettkampf, ein Spiel. Derjenige, der es als Erster schafft, eine fremde Welt zu besiedeln, hat das Spiel gewonnen!" "Na prima, dann gewinnen wir eben!", sagt Cäsar. "Dann ist das Spiel vorbei, und unsere Welt wird enden."
Cäsar schüttelt den Kopf. "Erwartest du im Ernst, dass ich den Start wegen einer so absurden Behauptung abbreche? Dass ich ein mehr als eine Billion Unos teures Raumschiff verschrotte? Der Finanzminister wird mir was husten!" Gelächter von den Zuschauerrängen. "Ich danke dir, lieber Unapietra, für deinen Beitrag zu diesem Projekt. Doch nun geh und störe uns nicht mehr!" Wächter bringen den jammernden und flehenden Physiker hinfort. Nur wenige Minuten später erhebt sich mit einer gewaltigen Feuersäule das Sternenschiff majestätisch in den Himmel. Das Ziel ist erreicht. Abspann.
Karl Olsberg promovierte über Künstliche Intelligenz, gründete zwei New-Economy-Firmen und entwickelte Computerspiele. Er arbeitet heute als Unternehmensberater in Hamburg. Sein Roman "Das System" über ein mörderisches Computervirus wurde für den Kurd-Laßwitz-Preis nominiert. Sein neuer Roman "Der Duft" erscheint im November im Aufbau-Verlag
Das Drehbuch von Oliver Uschmann
Herr Uschmann, setzen Sie sich. Was trinken Sie?" "Schwarzen Kaffee. Nur schlichten, schwarzen Kaffee." "Ich habe mir die ersten Kapitel Ihres Drehbuchs angesehen und muss sagen ..." "Ja?"
Der Agent lehnt sich vor, schiebt seine Brille auf die großporige Nase und sieht mich über ihre Ränder hinweg an: "Haben Sie sie noch alle?" "Bitte?" "Für so etwas haben wir bei der Filmstiftung Drehbuchförderung beantragt?" "Wo liegt das Problem?" Der Agent liest vor: "Marco Rossi begegnet zu -Beginn mittelklassewagengroßen Krebsen und Libellen, denen in hohem Bogen die Flügel ausfallen, wenn sie getroffen werden. Hat Rossi sich bis zum Campingplatz durchgekämpft, trifft er auf untote ehemalige Camper, deren Erbrochenes ihn selber in einen Zombie verwandelt. Diese Verwandlung macht ihn den Soldaten gegenüber allerdings unbesiegbar." "So ist es."
Der Agent füllt seine Nase mit Luft. Ihre Flügel weiten sich: "Als ersten Plot-Point schreiben Sie hier rein: 'Marco Rossi wird von einem gigantischen Bosskrebs über einen Bootsteg gejagt. Der Steg wird Stück für Stück vom Krebs gefressen, während der Gejagte nur wenig Raum hat, sich umzudrehen und Granaten auf das Untier zu werfen.' Uschmann, wir hatten von einem Fernsehspiel in Kooperation mit Arte gesprochen!" "Das weiß ich doch." Der Agent sackt zusammen und blickt mich an wie ein Molch. Dann schlägt er mit der flachen Hand auf die Papiere: "Hier steht: 'Ist Marco in einen Zombie verwandelt, kotzt er in einem fünf Meter langen Strahl Blut auf seine Gegner." Der Agent zittert. Es wachsen ihm Haare aus den Ohren. Hinter seinem Schreibtisch hängt ein Por-trät von Rainer Werner Fassbinder. Ich muss anfangen, seine Sprache zu sprechen. "Schauen Sie", sage ich, "dieser Plot symbolisiert die Bredouille des modernen Menschen in Zeiten von Globalisierung und gnadenloser Konkurrenz. Marco muss unablässig rennen, um zu überleben, und dabei bleibt ihm wenig Spielraum. Die Arbeitsbelastung macht ihn zum Zombie, krank vor Stress erbricht er Blut. Die Tiere sind Symbole für Krankheitssymp-tome. Die Libelle ist, wie Sie wohl wissen, das Wappentier der ,Pro Ana'-Bewegung, der 'freiwillig' Magersüchtigen. Den Krebs muss ich nicht erklären." Der Agent hört auf zu zittern. Er blättert im Manuskript. "Am Ende des zweiten Aktes wird Marco von Außerirdischen mit Grabsteinen beworfen ..."
Ich sehe den Mann an, so ruhig und fassbinderisch wie ich kann: "Die Grabsteine sind der Burnout, die Aliens stehen im wirtschaftskritischen Diskurs schon seit Jahren für die gnadenlosen Kräfte des Marktes." Der Agent schürzt die Lippen und sieht aus dem Fenster. Ich lehne mich vor und tippe auf die Mappe: "Deswegen gibt es keinen Dialog. Stattdessen nur Tempo und Gemetzel, Hektik und Gewalt, überzeichnet ins cartoonhafte, chaplineske. Weil da draußen nicht mehr geredet wird. Weil es blutig zugeht." Der Agent zündet sich eine Zigarette an, beobachtet eine Katze auf dem Fenstersims gegenüber, bläst langsam den Rauch aus der Nase und sagt: "Machen Sie weiter." Dann schweigt er. Ich stehe auf und lasse den Kaffee stehen. Ich habe die richtige Sprache gesprochen. Fassbinders Augen stechen mir in die Schulterblätter.
Oliver Uschmann, geb. 1977 in Wesel, studierte Literaturwissenschaft und war Packer, Kulturveranstalter und Fanziner. Seit 2005 entwirft er mit Sylvia Witt die "Hui-Welt" rund um die "Hartmut und ich"-Romane. Als Journalist schreibt er unter anderem für "Visions", "Galore" und "Am Erker"
Requiem In Motion von Sven Stillich
Er ist groß, ich bin klein. Er stampft ziellos herum, ich habe eine Mission. Er will leben, ich muss ihn töten. So ist das immer. So war es beim ersten, beim zweiten, so ist es bei diesem Riesen. Der Boden bebt bei jedem seiner Schritte. Ich versuche, mich an seinen Rhythmus zu gewöhnen. Um uns herum gibt es nichts. Nicht einmal einen Anschein von Welt. Nichts lenkt uns ab. Bei der nächsten Erschütterung springe ich. Jetzt. Ich springe, und ich kralle mich in die Fellbüschel an seinem Fußgelenk. Jetzt erst bemerkt er mich, sie bemerken mich immer, ich bin wie ein weicher Nadelstich. Der Riese beginnt zu laufen. Staub wirbelt auf. Er will mich abschütteln, doch ich klettere höher, seine Schenkel hinauf, ich mache Pause in seiner Kniekehle, dann weiter, höher, er schlägt nach mir, ich suche Schutz in jeder Ritze, ich weiß: Er will nichts Böses, nur seine Ruhe, will weiter einsam weiterstampfen. Ich weiß auch: Ich will nichts Böses, nur Rettung für das, was mir am Liebsten ist. Viele Tode für ein Leben.
Ich klebe an seinem Bauch, hafte an seiner Taille, jedes Brusthaar ist ein Baum. Ich muss auf seinen Rücken gelangen und von dort aus mich hochhangeln bis zu seinem Kopf. So war es beim ersten Mal, so war es beim zweiten, so ist es bei diesem Riesen. Ich presse meine Brust gegen seinen Körper. Ich besteige ihn. Wir sind uns nahe, ich kann ihn riechen, kann seine Angst riechen und sein Unverständnis. Meine Kleidung saugt sich voll mit seinem Schweiß. Womit habe ich das verdient, fragt er sich, womit habe ich das verdient, was habe ich getan? Da oben: Ich sehe schon das Mal, mein Ziel, die verwundbare Stelle. Der Riese windet sich, doch ich lasse nicht los, ich falle nicht, ich presse mich an ihn in seinem Rhythmus, es ist ein Tanz, er führt. Dann bin ich oben. Ich ziehe mein Schwert und ramme es in sein Genick. Er jault. Noch einmal. Er schreit. Wieder. Er taumelt. Und noch einmal. Er fällt. Und ich falle mit ihm. Staub senkt sich auf uns beide. Ich schaue in seine matten Augen, die mich nicht mehr sehen können. Um uns herum ist nichts. Nichts lenkt uns ab. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Wir sind leer. Beide leer. Von der Welt sind nur vier Augen übrig geblieben. Vier traurige Augen. Seine sind groß, meine klein.
Sven Stillich, geboren 1969, lebt als freier Journalist in Hamburg (unter anderem für "Stern", "Neon", "Zeit Wissen") und darf als Textchef für GEE arbeiten. Wurde jahrelang für seine "Galerie"-Texte mit GEE-T-Shirts bezahlt. Im vergangenen Jahr erschien sein erstes Buch "Second Life. Wie virtuelle Welten unser Leben verändern" (Ullstein)
Wer hat Angst vor Autoreifen? Oder: Was hat sich der Staat bei der Scheiße nur wieder gedacht von Thomas Venker
Aber jetzt! Ach, fuck. Ne, das pack ich nicht. Oh, oh, oh, oh. Hiiilllfeee. Ne, ne, so geht das nicht. Erst mal noch eine rauchen. Immer eine gute Idee. Hier geht das ja noch, inmitten der Autoabgase fällt es nicht auf, wenn man mal heimlich eine raucht. Diese Schweine aber auch: Auf einer Skala von 1 bis 100 geb ich den Politikern höchstens einen Punkt.
Was ist denn aus den tollen Freiheitsversprechen geworden, aus all den erkämpften Rechten der Zivilisationsgeschichte? In den Abfall gekickt wegen des scheinbaren Schutzes derer, die sich nicht wehren können. Ja, ja, rausgehen war ja noch okay, soll ja keiner sagen ich sei nicht rücksichtsvoll und sozial, aber jetzt auch nicht mehr draußen rauchen dürfen sondern nur im privaten Sektor - wie das schon klingt, privater Sektor! -, da hört doch alles auf. Wer kann sich denn einen privaten Sektor leisten? Ich doch nicht. Bin froh, wenn ich mal was zum Anziehen abstauben kann und nicht nackt durch die Gegend hüpfen muss. Aber schon verstanden: schützen, handeln mit gutem Gewissen. Das klingt als Leitmotiv ja soooo gut. Aber wie passt dann dieser Scheiß hier ins Bild: Da erzählen sie uns immer was von Umweltschutz, und dann das: Eine achtspurige Straße mitten durch die Stadt. Subventionsbetrug, ick hör dir quaken. Mal ehrlich, wer braucht schon vier Spuren in eine Richtung? Ich fordere: Schafft die Straßen ab, zerlegt die Bahngleise. Zurück zum Gras. Zurück zum Morast. Zurück zum Müßiggang. Zum entspannten Rauchen am sauberen Seewasser. Ach, träumen, das ist nur was für Kröten.
(Schnippt die Kippe wie James Dean in rebellischer Pose weg und blickt geradewegs auf die achtspurige Straße) Angst? Ob ich Angst habe? Ich doch nicht.
Los geht's! Und links, und rechts, puh, das war aber knapp, ah, uff, hey, du, du, du Arschloch, so schnell ist verboten, hey, nicht die Spur wechseln, hey, hey, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
Thomas Venker, geboren 1965 in Stuttgart-Zuffenhausen, gab eine Karriere als Tennisprofi auf für Literatur und Gin-Tonic. Sein Debüt -feierte er mit dem Feelgood-Drogen-Klassiker "Bohemian Desert" (Lautsprecher Verlag 2004). Aktuell erscheint ein Beitrag von ihm in der Anthologie "Madonna und wir. Bekenntnisse" (Suhrkamp). -Thomas Venker ist begeisterter Gleitschirmflieger
Der Fluch der Karibik von Burkhard Spinnen
Ich hatte mich mühsam hochgearbeitet - soweit "hocharbeiten" der richtige Ausdruck für die Karrierebemühungen eines karibischen Piraten ist. Aber in Arbeit war es ausgeartet, das beständige Abfangen und Niederkämpfen von Kauffahrtschiffen, die nur unwesentlich größer sein durften als mein Schoner, damit sie mich nicht mit einer zufällig gut gezielten Breitseite vom Wasser fegten. Und bis ich es endlich heraus hatte, die Pfeffersäcke vor dem Entern nicht allzu sehr zu beschädigen, damit ich ihre Ladung verkaufen konnte, war auch einige Zeit vergangen. Doch endlich hatte ich es geschafft: Ich war so geübt, dass ich eine beschädigte Brigg kapern konnte; und ich hatte so viel gespart, um sie auszurüsten und die hungrige und beutegierige Mannschaft zufriedenstellen zu können. Damals beginnt das schönste Kapitel meines Lebens. Ich war nun wirklich ein Freibeuter. Die Angebote, verlorene Halbbrüder zu suchen oder Gouverneurs-Töchterchen aus den Händen von Piratenkollegen zu befreien, schlage ich dankend aus. Stattdessen räubere ich mir zusammen, was ich zum Leben brauche, verfeinere dabei meine Angriffstechniken und schule meine Kanoniere, bringe mir selbst das Degenfechten bei und, ja, freue mich ansonsten daran, welch wunderbar romantische Lichteffekte sich zeigen, wenn die sinkende Sonne durch die müde flappenden Segel meiner ankernden Brigg scheint.
Alles hätte sehr schön sein können. Für immer, oder jedenfalls für eine lange Zeit, in der ich allabendlich eine gute halbe Stunde lang ein zufriedener Pirat gewesen wäre. Dann entere ich dieses Teufelsschiff, das wahrlich nicht wie ein solches ausgesehen hat. Doch als ich im Hafen seine Ladung verkaufen will, stelle ich fest: Seine Ladung ist ein Computerfehler, ein Bug! Es trägt in seinem Rumpf - unmöglich! - Millionen von wertvollen Planken und bringt mir ein Vermögen ein, wie ich es mir niemals hätte zusammenkapern können. Und statt irgendwann leer zu sein, ist der Plankenkahn gleich wieder randvoll: ein Goldesel in Form einer spanischen Galeone. Ich falle in Sünde.
Statt neu zu starten, spiele ich weiter. Doch jetzt regiert mich einzig die Gier. Ich überfalle ein zusammengeschossenes Geschwader großer Kriegsschiffe und rüste sie mit meinem Vermögen auf. Im Handumdrehen bin ich zum Alleinherrscher über die karibische See geworden. Nichts kann mir widerstehen - und das ist das Problem. Denn kaum begegnee ich einer Schatzflotte, schießen meine Dreidecker alles zusammen, und neben meinem fadenscheinigen Ruhm bleibt mir nichts. Und so muss der Plankenesel, der hinter meiner Armada herdümpelt, Mal um Mal meine Kriegskasse füllen.
Ich wende mich Aufgaben zu, die mir jetzt angemessen scheinen: Ich studiere Anleitungen zur Eroberung ganzer Inseln. Ich lerne, wie man geneigte Gouverneure einsetzt und Zwietracht zwischen den Inseln säht, damit das politische Klima der eigenen Expansionspolitik günstig ist. Ich schmiede Allianzen auf höchster Ebene. Ich fordere Vizekönige heraus und treffe auf Gegenwehr, die auch mir zu schaffen macht. Ich vergrößere meine Flotte, verliere Teile davon im Sturm und beschaffe mir eine noch größere Streitmacht. Ich gebe Unsummen aus und lasse meinem verbugten Plankenesel neue Unsummen ausspucken. Ich bin rastlos, gierig und größenwahnsinnig. Und nie wieder genieße ich es, mit meiner Brigg hart am Wind zu kreuzen, um einem Jäger zu entgehen. Nie wieder sehe ich, wie viel Mühe sich die Schöpfer mit den Lichtreflexen beim Sonnenuntergang gegeben hatten.
Bis mir die Einsicht kommt, dass falsch ist, was ich tue. Ich hatte ihn kennen gelernt: den wahren Fluch der Karibik. Ich setze meine Flagge auf dem Plankenschiff, um damit einer englischen Fregatte zu -begegnen, die mich erwartungsgemäß versenkt. Und ich mich plötzlich wiederfinde als Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel. Und ich bemerke: Um wieder von vorne anzufangen, als freier und ungebundener Pirat, fehlten mir Anreiz, -Frische und Elan. Vom Reichtum verführt und zugleich abgestoßen, bin ich für die Freiheit verdorben.
Wahrscheinlich kaufe ich mir jetzt eine Rennsimulation.
Burkhard Spinnen, geboren 1956, studierte Germanistik, Publizistik und Soziologie in Münster, wo er bis heute als freier Schriftsteller tätig ist. Er veröffentlichte rund zwanzig Bücher und gewann unter anderem den Literaturpreis der Konrad Adenauer-Stiftung, den Wirtschaftsbuchpreis der Financial Times und den Deutschen Hörbuchpreis
Gesammelt von: Oliver Uschmann, Illustration: Axel Pfaender (ITF)
Tags:
Burkhard Spinnen,
Felix Scharlau,
GEE 39,
Karl Olsberg,
Linus Volkmann,
Literatur,
Oliver Uschmann,
Sven Stillich,
Thomas Venker,
Tobias O. Meißner,
Vergiss mein nicht,
Videospielerfahrung